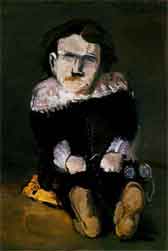 |
Selbst
als
Sebastian de Morra -
Hommage á Velazquez
1980
Oel/ Hartfaser
69 x 49,5 |
|
Was
auf Lutz Friedels Bildern zu sehen ist, ist schnell gesagt: ein
Horizont, ein Krater, eine Zypresse oder eine Muschel. Das Gegenständliche
ist aufs äußerste reduziert. Malte er einst mit Vorliebe
das Gewimmel an Badestränden, auf Straßen oder Rolltreppen
in seiner katastrophenträchtigen Brutalität und sind noch
die „Paradebilder" von I990 randvoll mit Köpfen
und Gestalten, so zeigte sich schon früh in der Serie der Selbstbildnisse
als Sebastian de Morra daneben ein Interesse an der konzentrierten
Metapher.
In den Flugzeugbildern
erarbeitete er sich dazu die Vereinfachung und Konzentration der
Form. Schwer und lastend, immer mit dem Gefühl einer Bedrohung
verbunden, schweben die Riesenleiber über den Häusern.
Das Widersinnige eines so schweren Körpers, der sich in die
Lüfte erhebt, wurde bei den springenden Fischen wieder aufgenommen.
Und auch hier will sich der Eindruck eines gelösten Spiels,
der Lust an der Überwindung der Schwerkraft nicht einstellen.
Das Erlebnis
Frankreichs und der französischen Kunst brachte eine Auseinandersetzung
mit Monets Heuhaufen und Manets Spargelbildern. Aber es bleibt nicht
bei der Schwelgerei in reicher Farbigkeit am unscheinbaren Objekt.
Wohl gewinnt Friedels Malerei mehr und mehr auch diese Qualität.
Doch die Heuhaufen werden ihm zu babylonischen Türmen, das
Spargelbündel zu einer alles überrollenden Riesenwalze.
Aber es sind auch mit stachligem Band aneinander gefesselte Phalli,
wie der einzelne Spargel der „Hommage a Manet" ein abgeschnittener
Phallus ist - die rote Schnittlinie durchteilt hart den hellen Grund
des Bildes. |
 |
Das
Buendel
1990
Oel / Bitumen/Leinwand
200 x 230
(Zustand) |
|
|
Nimmt
man „Das
Bündel" als Hochformat, so ähnelt es in Farbe
und Struktur der Darstellung des Birkenwaldes bei Oranienburg mit
dem erst auf den zweiten Blick erkennbaren, noch das militärische
Sperrgebiet markierenden Stacheldraht. Dieses Bild scheint seinerseits
eine Verwandlung der impressionistischen Birkenbilder von Christian
Rohlfs zu sein.
Den Magkeit
selbst noch im Schwarz, bis hin zu der satten Tiefe des Bitumens.
Das jedoch bringt seine Probleme mit sich, nicht nur hinsichtlich
der Haltbarkeit, sondernlereien mit phallischen Formen stehen die
mit vaginalen Assoziationen an der Seite - die Erdspalten und Krater,
Zypressen und Muscheln. Die reine Lust entfaltet sich allerdings
nicht, denn es sind auch bodenlose Abgründe und harte, verschlossene
Schalen. Selbst das überwältigende Italienerlebnis
brachte keine mediterrane Heiterkeit in die Bilder. Nur über
manchen Kratern schiebt sich fast schüchtern ein Stück
Himmelsblau in die Fläche, die sonst von düsterem Schwarz,
brandigem Rot, von ockrigen Beigetönen und stumpfem Braun beherrscht
wird. Freilich: Ein langer Malprozeß läßt in diesen
Tönen eine schier unendliche Vielfalt entstehen. Manchmal liegen
sie lasierend übereinander, sind zu feinen Schwebungen verrieben,
dann wieder hingespachtelt, miteinander verknetet, spröde aufreißend.
Welche Lebendi auch wegen seiner Endgültigkeit. Seine Schwärze
erhöht Reiz und Wirkung der Bilder, nimmt ihnen allerdings
gleichzeitig - wenn auch zunächst vielleicht nur für den
Maler selbst spürbar - etwas von ihrer Wandlungsfähigkeit.
Denn was er gelegentlich als Unsicherheit oder Unentschlossenheit
empfinden mag - eine gewisse Scheu vor der Entscheidung, ein Bild
als abgeschlossen zu betrachten -, ist in Wahrheit eine zentrale
Qualität dieser Arbeiten, die sich immer noch aus dem Hellen
ins Dunkle wandeln können oder umgekehrt. Andererseits unterstützt
das Bitumen in seiner Gewaltsamkeit eine Tendenz, die sich vor allem
im Duktus der manchmal geradezu zerschundenen Oberfläche ausdrückt
und sich gegen die herbe, aber nicht zu leugnende Farbschönheit
zu sträuben scheint.
Das Thema Lutz
Friedels ist eigentlich noch dasselbe, das er schon früh anschlug:
die trügerische, aus sich selbst heraus in Gewalt und Katastrophe
umschlagende Idylle. Er hat ihm alles Anekdotische genommen, es
in klare Metaphern gefaßt und läßt die Dramen sich
in der Farbmaterie selbst abspielen. Es zeigt sich, daß dies
ein übergreifendes Thema ist, von dem die DDR-Problematik nur
ein Aspekt war. Aus dem Norden kommend, gewahrt man auch über
der klimatischen und kulturhistorischen Idylle Italiens den sie
bedrohenden Schatten, der unter anderem der eigene ist. Lutz Friedel
malt keine Figurenbilder mehr, aber er spricht in seiner Malerei
vom Menschen.
Andreas Hüneke
|

